Hybride Wertschöpfungspotenziale in kleinen und mittelgroßen Unternehmen
- Datum
- 25.03.2021
Die fortschreitende Digitalisierung und die Entwicklung zu Industrie 4.0 bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich mit neuen Formen der Wertschöpfung und neuartigen Geschäftsmodellen zu stärken. Im ESF-geförderten Projekt "ABILITY - Ganzheitliche Befähigung zur Hybriden Wertschöpfung" wird ein umfassendes Befähigungssystem mit KI-gestützter Lernumgebung für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) erarbeitet, mit dem hybride Wertschöpfungspotenziale identifiziert, bewertet und umgesetzt werden können.
"Hybride Wertschöpfung"? - manche*r Newsletterleser*in wird sich wahrscheinlich fragen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Verkürzt dargestellt geht es um die Verschmelzung von Sachgütern (Produkten) mit Dienstleistungen, die wiederum als kundenspezifische Gesamtlösung angeboten werden. Diese können von den Unternehmen selbst oder in Wertschöpfungsnetzwerken erbracht werden.
Der Vorteil für das Unternehmen? Die Kombination von Produktion und Dienstleistung bietet den Unternehmen vielfältige Chancen. Beispielsweise kann durch die Verbindung des Güter- und des Dienstleistungsangebots ein zusätzlicher Nutzen für die Kunden geschaffen und damit auch die Kundenbindung gesteigert werden. Und durch eine stärkere Einbindung des Kunden bei der Entwicklung und eine umfassende Unterstützung beim späteren Einsatz des Produkts, z.B. einer Maschine oder Anlage, können dessen Bedürfnisse schneller erfasst und bedient werden. Darüber hinaus stehen durch die Rückkopplung Daten aus dem laufenden Betrieb zur Verfügung, z.B. durch eine Internet-basierte Fernwartung, und können zur (schnelleren) Optimierung und Anpassung aktueller und zukünftiger Produkte genutzt werden.
Um beim Beispiel Anlagen-/Maschinenbau zu bleiben: Eine Produktionsanlage kann zusammen mit unterschiedlichen Dienstleistungspaketen angeboten werden, die den Kunden beim Anlagenbetrieb unterstützen - von der (vorbeugenden) Wartung über die Nutzungs-Optimierung bis zu Mitarbeiterschulungen.
Allerdings stellt der notwendige Transformationsprozess zur hybriden Wertschöpfung die Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel sind eine kreative Neuausrichtung des Denkens sowie eine Anpassung oder gar eine Neuentwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Besonders KMU ohne eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen fehlt es hier neben dem fachlichen Know-how zu hybrider Wertschöpfung auch an notwendigen Ressourcen, derartige Transformationen selbst in Gang zu setzen.
Das Projekt "ABILITY" unterstützt Unternehmen dabei, indem es ein sogenanntes Ganzheitliches Befähigungssystem entwickelt. Es besteht aus einem Phasenmodell der Transformation, einer KI-unterstützten personalisierten Lernumgebung und einer Toolbox für hybride Geschäftsmodelle. Dieser Ansatz berücksichtigt die Dimensionen Technik-Organisation-Personal (T-O-P), die verschiedenen Ausgangssituationen der KMU und ermöglicht deren Weiterentwicklung bzw. eine disruptive Neuausrichtung.
Phasenmodell
Das Phasenmodell wird gemeinsam mit den Anwendungspartnern aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, des Werkzeug- und Vorrichtungsbaus sowie der Oberflächenveredelung validiert und in das Befähigungssystem integriert. So wurden in Kooperation mit den Anwendungsunternehmen die jeweiligen aktuellen Geschäftsmodelle aufgenommen, visualisiert und analysiert.
Auf Grundlage dieser Analyse wurden in Kreativ-Workshops Ideen kreiert, wie hybride Wertschöpfung im eigenen Unternehmenskontext aussehen könnte und erste Prototypen (s. Abbildung 1) und Umsetzungskonzepte entwickelt. Im Anschluss wurden diese mit Hilfe eines neuentwickelten Bewertungsansatzes anhand der Kategorien "Vorhandene Fähigkeiten", "Prognostizierte Erfolgspotenziale" und "Servicegrad der Idee" bewertet. Gut bewertete Ideen wurden zum Teil bereits in produktbegleitende Dienstleistungen überführt und auf Grund des Feedbacks der Kunden aus der Praxis Schritt für Schritt angepasst.

Schulungskonzept und Empfehlungssystem
Die Forschungspartner haben parallel die Grundlagen hybrider Wertschöpfung und relevante Begriffe bzw. Sachzusammenhänge in einer Schulung gebündelt, um ein einheitliches Verständnis innerhalb des Projekts sicherstellen zu können. Des Weiteren wurde eine strukturierte Best-Practice-Datenbank mit bereits realisierten hybriden Geschäftsmodellen aus zahlreichen Branchen als Basis für ein (KI-gestütztes) Empfehlungssystem erstellt.
Kern des Ganzheitlichen Befähigungssystems ist das Phasenmodell der Transformation. Es führt das Unternehmen von der Phase "Aufmerksamkeit" bis zur Phase "Betrieb und Aufrechterhaltung" durch den Transformationsprozess. Für das Phasenmodell wurden Werkzeuge entwickelt, zusammengetragen und standardisiert dokumentiert. Das Befähigungssystem wurde bereits als erste digitale Visualisierung in das Lernmanagementsystem LMS Canvas überführt, welches nach und nach Lerninhalte in verschiedenen Formen bereitstellen wird, wie zum Beispiel Web-Based-Trainings, Impulsvorträge und Anleitungen, zur nutzerspezifischen und individuellen Befähigung.
Das Konsortium des "ABILITY"-Projekts besteht aus dem FESTO Lernzentrum, dem Lehrstuhl für Produktionssysteme der Ruhr-Universität Bochum, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem wi institut der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, der Brabant & Lehnert Werkzeug- & Vorrichtungsbau GmbH, der RINK GmbH & Co. KG und der Jacobi Eloxal GmbH.
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt "ABILITY" finden Sie hier.
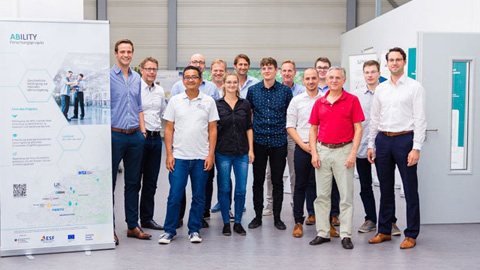
Das Programm "Zukunft der Arbeit"
Das Forschungs-und Entwicklungsprojekt "ABILITY" wird im Rahmen des Programms "Zukunft der Arbeit" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Das Programm greift die Herausforderungen auf, die für Unternehmen (insbesondere KMU) und Menschen durch Strukturwandel, Technisierung und zunehmende Globalisierung in der Arbeitswelt entstehen, und lädt Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein, mit innovativen Forschungsprojekten aktiv die Zukunft unserer Arbeitswelt mitzugestalten. Ziel des Programms ist es, technologische und soziale Innovationen gleichermaßen voranzubringen. Dazu sollen neue Modelle der Qualifizierung, der Gesundheitsprävention, der Arbeitsgestaltung und -organisation in und mit Unternehmen entwickelt und als Pilotprojekte in die betriebliche Praxis überführt werden. Dabei liegt der Fokus besonders auf branchenübergreifenden und interdisziplinären Projekten.
Weiterführende Informationen zum Programm "Zukunft der Arbeit" finden Sie auf dem ESF-Webportal sowie auf der Programmwebsite des BMBF.